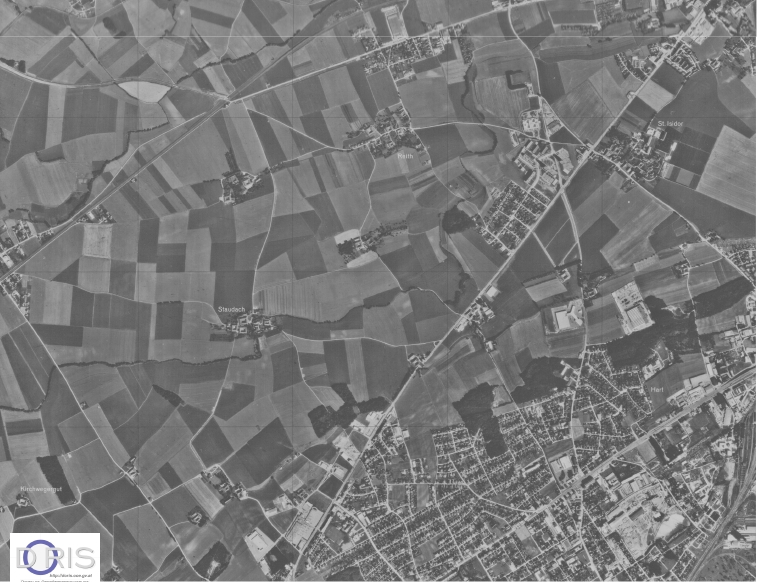Abschnittsübersicht
-
Raumordnung in Österreich
Diese Web-Plattform entstand anlässlich einer Lehrerfortbildungan an der PH-Linz am Mi. 30.1.2013 mit den Thema "Österreich - kompetenzorientiert unterrichten"; Maria Hofmann-Schneller stellte ein erstes Ressourcen-Portfolio zusammen.
Er ist weiters Teil der Lehrveranstaltung "Österreich 2: Wirtschaftsstruktur und Raumordnung" im WS 2013/14 sowie WS 2015/16 in der Ausbildung zum GW-Lehrer / zur GW-Lehrerin an Neuen Mittelschulen an der PH-Linz.
Darüberhinaus nutzt diesen Lernkurs die Lehrerfortbildung "Raumordnung im kompetenzorientierten Unterricht" von Alfons Koller am Mo. 17.3.2014.
-
-
-
Zur Suche: Landesgesetz - OÖ - Raumordnung
beispielsweise:
-
Für A1-Kunden sind Abfragen vom Grundbuch, Firmenbuch, Melderigister, Gewerberegister kostenpflichtig möglich. Der Betrag von 3 - 4 EUR im Grundbuch wird über die Telekom-Rechung abgerechnet.
-
-
In: Die Presse, 13.10.2015, S. 16
-
In: Oberösterreichische Nachrichten, 13.10.2015, S. 26
-
-
-
Eine Alternative zu den Raumbeschreibungen in den Österreichklassen unserer Schulbücher
-
Rheintal (Dornbirn, Lustenau), Alpiner Raum (Hallstatt, Sölden, Schruns), Wiener Becken (Wiener Neustadt, Mistelbach) Vorland im Osten und Südosten (Neusiedl, Fürstenfeld).
-
3. Klasse NMS/AHS (7. Schulstufe): Wir und wo wir gerne wohnen würden.
Methodischer Vorschlag 1
- Phantasiereise "Wir suchen unser Traumhaus"
- Betrachte die Bilder, vergleiche mit Traumhaus
- Lokalisiere dein Traumhaus auf einem Stadtplan und begründe (Typisierung von Wohnsiedlungen).
- Plan: Zeichne deine Traumsiedlung.
Lernziele
- Erkennen, dass es individuelle Vorstellungen von idealem Wohnen gibt.
- Im Stadtbild kann ich die Art der Gebäude erkennen.
-
7. Klasse AHS (11. Schulstufe): Eine Region setzt sich in Szene - Regionalentwicklung durch Sportveranstaltungen
-
Rosemarie Schwaiger (2013) Landschaftsflegel: Schladming erstickt in teuren Bausünden.- In: Profil online 22.1.2013. Web: http://www.profil.at/articles/1303/560/350614/landschaftsflegel-schladming-bausuenden (30.1.2013)
-
Statistik Austria (o.J.) Ein Blick in die Gemeinde: Schladming.- Web: www.statistik.at
-
Michael Steiner (2012) Die Weltmeisterschaft in Schladming: Was bewirkt zusätzlicher Tourismus?. Kurzfassung. Studie im Auftrag des BMWFJ.- Graz: Eigenverlag. 9 S.
-
Franziska Leeb (2012) Im Zielschuss zu wenig Baukultur.- In: Raum H. 88, S. 10 - 13.
-
Michael Steiner (2012) Die (Regional-)Ökonomie einer Ski-WM.- Raum H. 88, S. 14 - 18.
-
Martin Weishäupl (2012) Eine nachhaltige Ski-WM geht das überhaupt?.- In: Raum H. 88, S. 19-21.
-
Aus dem GW-Unterricht im Petrinum.
- Bitte mit Gast-Login anmelden.
-