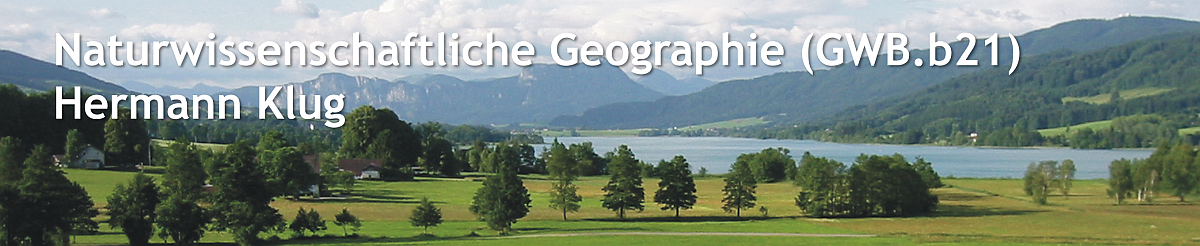
Die Lernkurse, welche die Lehrveranstaltung zur naturwissenschaftlichen Geographie von Hermann Klug begleiten, sind aus urheberrechtlichen Gründen nur intern für die inskribierten Studierenden verfügbar. Fernziel ist es auch hier, Open-Educational-Resources (OER) anzubieten; bis dahin wird es aber noch ein wenig dauern.
@Studierende: Bitte melden Sie sich in PlusOnline zur Vorlesung an. Stellen Sie sicher, dass Sie auf der LernplattformGW einen Zugang besitzen. Entweder werden Sie dann automatisch in die Lernkurse eingebunden oder Sie kommen am Donnerstag vor oder nach der Vorlesung zu Alfons Koller, der Sie dann manuell einbinden wird.
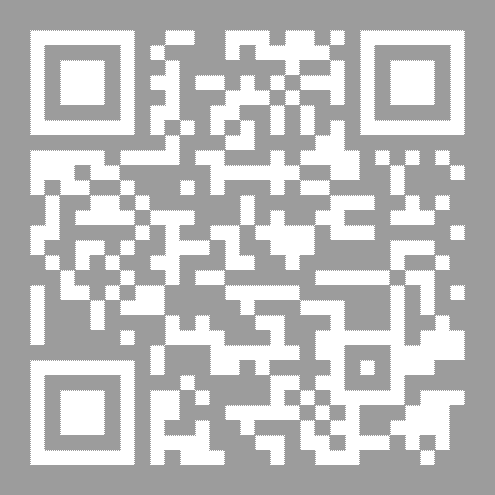
25S_GWBb21 - VU - Naturwissenschaftliche Geographie für das Unterrichtsfach GW (PH Linz)
Für eine qualitätsorientierte Lehre sind wir auf die Rückmeldung der Studierenden angewiesen. Dafür hat die Universität Salzburg einen eigenen Umfragebogen konzipiert. Direkt zu der Bewertung kommt ihr über folgenden Link: https://k31167.evasys.de/evasys/online.php?pswd=6P15H oder den QR-Code. Die Evaluierung habe ich ein zweites Mal öffnen lassen, da es nur fünf Rückmeldungen gab. Wir würden uns über eine größere Beteiligung freuen. Danke!
In diesem Ordner finden Sie das wichtigste Dokument der Lehrveranstaltung: VU_NaturwissenschaftlicheGeographie.pdf. Es beinhaltet eine Kurzbeschreibung der Vorlesung, spezifiziert sämtliche Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und administrative Vorgehensweisen. Neben der Darstellung der Lernziele, Kompetenzen und den zu erreichenden Fähigkeiten werden Hinweise in der LV eingesetzten und empfohlenen Literatur gegeben. Darüber hinaus werden Informationen zur Lernzielkontrolle am Ende des Semesters bereitgestellt und Verbindungen zu weiterführenden Kursen hergestellt.
Das Forum dient zum Austausch von Fragen und zur Kommunikation unter den Studierenden. Nutzen Sie die Möglichkeit, um bei etwaigen Schwierigkeiten Hilfe von Ihren Kommilliton/innen zu bekommen.
Ein Glossar hat viele Verwendungsmöglichkeiten. Hier soll es speziell als eine kollaborative Sammlung von Schlüsselbegriffen verwendet werden. Diese Sammlung soll von den Studierenden erstellt und mit nützlichen Bildern bzw. Audio-/Videodateien angereichert werden.
Neben der Präsenzlehre bieten wir über ZOOM (https://zoom.us/j/5310229758) eine Live-Schaltung in den Vortragsraum der Naturwissenschaftlichen Geographie an. Sie benötigen für die Anmeldung ihren Zugang zur Lernplattform, eine stabile Internetverbindung, einen Desktop/Laptop sowie einen Lautsprecher zum Empfang der Sprache. Das Mikrofon ist bitte stumm geschaltet. Fragen werden nur aus dem Präsenzpublikum entgegen genommen. Damit stellt die Live-Übertragung eine Möglichkeit einer Teilnahme im Krankheitsfall oder bei Terminüberschneidungen dar. Aufgrund unserer Prüfungserfahrungen wird sehr empfohlen, die VU in Präsenz zu konsumieren.
Studierende können sich in der Uni Salzburg über Eduroam per WLAN mit dem Internet verbinden. Ferner können Sie auf öffentlich zugänglichen PCs in der Bibliothek oder den Computerräumen per LAN auf das Internet zugreifen. Von Zuhause aus können die Studierenden sich über einen VPN (Virtual Privat Network) ebenfalls mit der Uni Salzburg verbinden und damit im Lehramtscluster Österreich Mitte kostenfrei auf Literatur der Verleger Elsevier, Springer, UTB und andere zugreifen.
Große Teile der Präsentation finden sich in schriftlich ausgeführter Version in der Datei VU_NaturwissenschaftlicheGeographie.pdf. wieder. Ein Überblick über die Struktur und die zu behandelnden Inhalte der Vorlesung wird dargelegt. Darüber hinaus sind den Inhalten Informationen zum Angebot der Exkursion ins Dachsteingebirge und der Fachliche Erweiterung GW B 2.2 im Rahmen eines Geländepraktikum im Landschaftslabor Koppl zu entnehmen.
Inhaltlich starten wir Atmosphäre und setzen uns mit ihrer Entwicklung, Zusammensetzung und ihrem Aufbau auseinander. Wir betrachten den Mond und seine geophysikalischen Auswirkungen auf die Erde. Im Rahmen der Diskussion um Treibhausgase beziehen wir den Klimawandel und den Kohlenstoffkreislauf mit in die Betrachtung ein, bevor meteorologische Größen wie der Luftdruck behandelt werden.
In dieser Einheit wird das Thema Wasser in der Atmosphäre auf Basis der Aggregatzustände (flüssig, fest, gasförmig), Phasenübergänge (verdunsten, verdampfen, kondensieren, gefrieren, schmelzen, sublimieren) sowie weitere Eigenschaften (Dipol, Wasserstoffbrückenbindung, Cluster, spezifische Wärme, Dichte, Volumenwärme), Feuchtemaße (Sättigungsfeuchte, spezifische/relative Feuchte, Taupunkt) behandelt und die Phänomene (z. B. Inversion) an praxisnahen Beispielen erläutert. Ferner finden die Prozesse des Niederschlags und verschiedene Formen der Verdunstung Eingang in diese Einheit.
Die Studierenden lernen die Keplerschen Gesetze und deren Einfluss auf den Strahlungshaushalt der Erde kennen. Sie können das Gravitationsgesetz in den Strahlungshaushalt einordnen und auf Basis eines Diagramms die Solarstrahlung, Tageslängen und Sonnenhöhe bestimmen sowie daraus Energiebilanzen zusammenstellen. Es werden verschiedene Wärmestrahlungs- und Wärmehaushaltsprozesse sowie das elektromagnetische Spektrum behandelt. Wellenlängen, Maßeinheiten und physikalische Strahlungsgesetze (Plank, Kirchhoff) werden in den Gesamtkontext eingeordnet.
In dieser Lerneinheit befassen wir uns mit dem Wienschen Verschiebungsgesetz und bestimmen damit die energiereichste Wellenlänge eines Körpers sowie nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz die von einem strahlenden Körper ausgehende Gesamtenergiemenge. Wir lernen verstehen, dass mit zunehmender Masse auch Wasser nicht durchsichtig ist und können dies mit dem Extinktionsgesetz (Bouguer-Lambert-Beersches Gesetz) erklären. Brechungs- und Reflexionsgesetze werden an Regenbogen und Halo-Erscheinungen studiert und Strahlungsenergieströme mit dem Lambertschen Gesetz ermitteln. Solare Einstrahlung und terrestrische Ausstrahlung werden in Strahlungsbilanzmodellen gegenübergestellt.
Die sechste Lerneinheit greif auf bestehendes Wissen zurück und stellt die Zusammenhänge des Energiehaushaltes der Erdoberfläche als Synthese dar. Unterschiede zwischen Bodenwärmeströme und Wärmeströme latenter Energie sowie den Strom fühlbarer Wärme werden erläutert und in Zusammenhang mit wirtschaftlichen Anwendungsfelder (Oberflächennahe Geothermie) gestellt. Ferner lasse sich die erworbenen Erkenntnisse zum persönlichen Schutz (Schlafplatz im freien, Blitzschutz) anwenden.
Nachdem die atmosphärischen Grundeigenschaften, Zustände und Prozesse erlernt wurden, wird in dieser Einheit die Entstehung von Windsystemen und deren Beeinflussung durch weitere Kräfte (Coriolis- und Zentrifugalkräfte) behandelt. Die Studierenden lernen die Beeinflussung durch Reibung (Rauigkeit) und daraus resultierende aerodynamische Eigenschaften kennen, welche wiederum zur Planung von für Ausgleichs- und Wirkungsräumen wichtig sind. Es werden Messinstrumente und Einheiten für Windgeschwindigkeiten und Windrichtungen behandelt und Beispiele für Thermik und Turbulenz dargelegt.
Im zweiten Teil der Windsysteme lernen wir verschiedene lokale bis (über-)regionale Windsysteme kennen (Flurwind, Land-/Seewind, Hangwinde, Aus-/Abwinde, Berg-/Talwind, Föhn) und können weitere Windsysteme wie z. B. Bora, Mistral und Schirokko räumlich zuordnen. Sie verstehen die Bildung von Kaltluft, deren Steuermechanismen und deren Einflüsse im prozessualen Zusammenhang und greifen das Verständnis zu Hochdruck- und Tiefdruckgebieten noch einmal ab um damit zusammenhängen Luftbewegungen charakterisieren zu können.
Ausgehend von den atmosphärenphysikalischen Kenntnissen gehen wir auf die Unterscheidung von Klima und Wetter ein. Das Klimasystem der Erde mit seinen Subsystemen und seinen atmosphärischen Prozessen wird in Zusammenhang gebracht und Datenerfassungsmethoden und verschiedene Datenquellen zur Interpretation der Temperaturschwankungen der Vergangenheit kennengelernt. Diese können in Bezug zu den erwarteten Herausforderungen des Klimawandels gesetzt werden als auch für verschiedene räumliche und zeitliche Skalen eingeordnet werden.
Die zehnte Lerneinheit führt die Inhalte zum Klimawandel etwas weiter aus. In diesem Zusammenhang werden Ozeanzirkulationen besprochen und der Einfluss des Klimawandels auf den Alpenraum thematisiert. Neben der Besprechung spezieller Datensätze aus HISTALP werden auch andere Projekte besprochen, welche die zahlreichen Facetten des Klimawandels und dessen Anpassungs- und Mitigationsstrategien erörtert. Abschließend werden die abschmelzenden Alpengletscher am Bespiel historischer und rezenter Fotografien thematisiert. Das Gestaltungspotenzial der Gletscher leitet dann in das neue Thema zu verschiedenen Oberflächengestalten der Erde über.
Das Fachgebiet der Geomorphologie gehört zu den klassischen Lehreinheiten der naturwissenschaftlichen Geographie und vermittelt Wissen über die in der Landschaft ablaufenden Prozesse und deren daraus resultierenden Formen. Dabei spielen die Erkenntnisse aus den Lehreinheiten über die Atmosphäre eine entscheidende Rolle, denn die exogenen Faktoren wie Strahlung und darauf resultierenden klimatischen Bedingungen und Wetterbedingungen sind oftmals die treibenden Kräfte hinter den Prozessen und Formen. Aber auch endogene Kräfte und Prozesse werden behandelt und runden das Verständnis zu reliefbildenden Prozessen ab. Speziell wird in dieser Vorlesung auf den Durchdringungsbereich von Gestein (Lithosphäre), Wasser (Hygrosphäre), Boden (Pedosphäre, Lebewesen (Biosphäre) und Luft (Atmosphäre) eingegangen. Es werden erneut Größenordnungen thematisiert und auf die Hypsometrische Kurve eingegangen. Diese Größenordnungen werden über die Darstellung der Zeitgliederung und Nomenklatur des Quartärs vertieft und die räumliche Verbreitung der Inlandsvereisung in Nordeuropa und den Alpen angesprochen. In diesem Zusammenhang werden bereits einige Reliefformenschätze genannt und Prozesse wie die isostatische Hebung Skandinaviens besprochen.
In der zweiten Einheit zur Geomorphologie werden die Inhalte aus der vorherigen Vorlesung vertieft. Die Vertiefung hat die Erläuterung der Formenschätze, deren genetischen Prozessen und heutigen Eigenschaften zum Ziel. Die Studierenden lernen glaziale Prozesse wie Transport- und Ablagerungsarten kennen und können die relative räumliche Lage der Formenschätze in der glazialen Serie erläutern. Die einzelnen Elemente der glazialen Serie (z. B. Oser, Kames, Sölle, Rundhöcker, Drumlins, Trogtäler, Zungenbecken, Moränen) werden vorgestellt. Diese Inhalte leiten denn in der folgenden Vorlesung zu den Periglazialgebieten mit seinen Sandern und Urstromtälern weiter.
Vorlesung 13 wiederholt die Inhalte der glazialen Serie mit Glaziale Erosions-, Transport- und Ablagerungsarten und erweitert die bekannten glazialen Formenschätze um Prozesse und Repräsentationsformen in den Periglazialgebieten. Die Studierenden lernen neben der Verbreitung von Permafrostgebieten auch Prozesse und Strukturen der kryogenen Reliefbildung kennen. Speziell wird auf Eiskeile, Pingos, Kryoturbationen, Steinringbildung Frosthub und Frostdruck eingegangen.
Die Lerneinheit 14 setzt an die Erkenntnisse der flächenhaften Abtragung (Denudation) an und erläutert die Begriffe und Prozesse zu Massenbewegungen wie Erdfließen, zur Kriechdenudation, zur Gelifluktion und deren sichtbaren Hinweise im Gelände (z. B. Säbelwuchs). Die Studierenden lernen die Effekte und Bedeutung der Spüldenudation kennen und können den Plantscheffekt von Regentropfen erläutern. Elementare Eigenschaften des Reliefs können benannt und eingeordnet werden. Aus den Erosions- und Ablagerungsprozessen entstehen elementare Eigenschaften des Reliefs, welche die Studierenden über ihre relative Position, Exposition und Wölbung erklären können. In einer Synthese des geoökosystemfaktors Relief mit dem Prozessbereich von Klima, Biosphäre und Hydrosphäre werden in jeweiligen Steuerelemente und Zusammenhänge noch einmal zusammengeführt.
Die letzte Vorlesung in der fünften Blockveranstaltung vertieft die bereits angesprochenen äolische Denudation. Das Wissen der Prozesse um das periglaziale äolische Sediment Löss in der Korngrößenfraktion des Schluff erweitert. Speziell wird das Verständnis von Prozessen und typischen Deflationsformen und Dünenbildung erweitert und die räumliche Verbreitung besprochen. Dabei wird auf die drei Arten des Sandtransportes (Suspension, Saltation, Reptation) eingegangen. In Folge wird über das Thema des Gesteinskreislaufes auf das Thema Verwitterung überführt. Damit wird der Bogen gespannt, um Massengesteinen in Feinmaterialdecken zu überführen, welche wiederum erosions-, transport- und ablagerungsfähig sind.
Mit Abschluss der letzten Einheit wurden Verwitterungsformen in den jeweiligen Prozessgruppen (chemisch, physikalisch, biologisch) angerissen, welche im Folgenden vertieft werden. Nach einem Fokus auf der physikalischen (Insolationsverwitterung, Frostverwitterung, Salzsprengung, Druckentlastung, Hydroklastik) und der biologischen Verwitterung (Rhizoklastik) erfolgt mit der Hydratation und der Protolyse der Übergang zur chemischen Verwitterung. Als Kombination mechanisch-chemischer Verwitterung wird die thematisiert.
Die Verwitterungsformen führen uns zu Prozessen der chemischen Verwitterung von Silikaten und Carbonaten. In diesem Zusammenhang wird näher auf die Hydrolyse eingegangen und es werden charakteristische Formenschätze im Karst besprochen.
Den Abschluss der Prozesse zur chemischen Verwitterung bildet die Oxidation, welche noch einmal in den Gesamtzusammenhang von Carbonatisierung und Hydrolyse gestellt wird. Von den kleinsten Einheiten der Verwitterung – den Kristallgittern – geht es über zur Erläuterung von diversen Prozessen und Formenschätzen an Küsten. Dabei wird auf Aspekte von bereits besprochenen atmosphärenphysikalischen und eiszeitlichen Fakten zurückgegriffen.
Einzelne Vulkantypen, ihre Merkmale und Eigenschaften formen vulkanische Landformen, welche Großteils an Bildern aus Neuseeland dargestellt werden. Von den Vulkanen leiten wir über zu den Großlandschaften und beschäftigen uns mit Rumpfflächen und deren Genese. Dabei greifen wir das Wissen zur marinen Abrasion wieder auf und lernen verschiedene Theorien von Davis, Penck und Hack kennen. Diese führen uns weiter zu Schichtstufen-, Schichtkamm- und Schichttafel-Landschaften, welche wir sowohl in Bezug zu ihrer Genese als auch den sie repräsentierenden Formenschätzen besprechen.
Mit Abschluss der Inhalte zur Geomorphologie und Geologie widmen wir uns der Hydrologie. Die wasserbezogenen Inhalte der Vorlesungen zur Meteorologie werden wieder aufgegriffen, vertieft und in Bezug zum lokalen bis globale Wasserkreislauf gestellt. Dabei werden die Inhalte zum Wassermolekül noch einmal aufgegriffen und vertieft. Im Sinne der Betrachtung von Einzugsgebieten werden Verteilungen und Beobachtungen von festen und flüssigen Niederschlägen und der Bestimmung von Starkregenereignissen und die Analyse von Zeitreihen thematisiert. Über die Verdunstung geht es über die Besprechung von Lysimetern zum Bodenwasserhaushalt über.
Wir schließen an den Bodenwassserhaushalt der letzten Stunde an und eignen uns Wissen über die Wasserspannung und den Wassergehalt bei verschiedenen Bodenarten (Ton, Schluff, Sand) und entsprechenden Porengrößen an. Dazu stellen wir die Begriffe Feldkapazität (FK), nutzbare Feldkapazität (nFK) und Permanenter Welkepunkt (PWP) in Bezug. Es wird vermittelt wie Wasserflüsse (abwärts, aufwärts) erfolgen. Es wird die Wasserleitfähigkeit (Darcy) in Böden bei unterschiedlichem Wassergehaltes, bei Bewässerung bzw. Entwässerung (Hysterese) kennengelernt.
Wir ergründen diverse Aspekte zum Thema Grundwasser (Grundwasserstockwerke, Brunnen, Fließwege und Fließgeschwindigkeiten). Weiter beschäftigen wir uns mit dem Thema der Abflussbildungsprozesse (Direktabfluss, Basisabfluss, Zwischenabfluss) und Abflusskonzentrationsprozesse (Durchfluss) und leiten dieses Thema in Oberflächenabfluss (Horton'scher Abfluss, Dunn'scher Abfluss) über.
Wir erweitern unser Wissen zum Oberflächenabfluss und betrachten speziell das fluviale System. Unterschiedliche Wasserflüsse (Wasserfall), Fließformen (verwildert, mäandrierend, gerade, anastomosierend), Darstellungsformen (Talformen), Erosionsformen (rückschreitende Erosion) und Akkumulationsformen entlang eines Flusslaufes werden behandelt. Abflüsse im Gewässer werden inklusive Niederschlag Abfluss Beziehungen und daraus entstehenden Flusssystemen betrachtet. In diesem Zusammenhang erläutern wir Begriffe wie Durchflussganglinie, charakterisieren Flusslängsprofile, ergründen was es mit der Fluss-/Gewässerordnungszahl auf sich hat und lernen, etwas über die Bewegung und Transporteigenschaft des Wassers im Fluss (laminares und turbulentes Fließen, Arten der Flussfracht, Hjulström-Diagramm) kennen. Ausbildungen von Prallhängen und Gleithängen sowie die weiterführend daraus entstehenden Mäander werden thematisiert. Dieser Blickwinkel leitet vom Flusslängsprofil von den Bergen bis zum Ozean zu einem Flussquerprofil über.
Wir schließen die Betrachtung des Oberflächenabflusses der vorherigen Stunde ab und leiten zur Versickerung über. Die Versickerung und Wasserflüsse im Boden (Interflow) inkl. der Erfassung und Analyse der Bodenfeuchte und ihre ökologische Bedeutung werden inhaltlich und schematisch an Prozess-Korrelations-System behandelt. Abschließend werden die Ozeane im Zusammenhang mit dem Klimasystem sowie dem Kohlendioxidkreislauf noch einmal betrachtet und das bisherige Wissen erweitert.
In dieser Veranstaltung soll fundiertes Grundlagenwissen über die Böden und ihre Entwicklung vermittelt werden. Die bodenkundlichen Grundbegriffe werden erläutert, die Ausgangsgesteine mit ihrer räumlichen Verbreitung, den wichtigsten Mineralien und ihren Eigenschaften dargestellt. Angefangen von den physikalischen, chemischen und biogenen Prozessen der Verwitterung des Ausgangsproduktes (Gestein / Sediment) führt die Entwicklung des Bodens über Bodenbildungsprozesse (Humusbildung und -abbau, Moorbildung, Mineralbildung, Entkalkung/Versauerung, Verlagerung von Stoffen, Redoxprozesse) zu den verschiedenen Ausprägungen der Böden Mitteleuropas. Diese werden im Kontext ihrer Bodenvergesellschaftung näher beschrieben und die Dynamik des Systems Boden erläutert. Ebenso zählen Aspekte wie das Bodengefüge, die Bodenluft, das Bodenleben wie auch Grundlagen des Wasserhaushaltes zum Lehrinhalt. Mit Abschluss der Vorlesung sollen die Studierenden einen Einblick in das dynamische System Boden erlangt haben und ihn im Kontext weiterer Bestandteile im Ökosystem einordnen können. Dies inkludiert die kleinsten Einheiten, die Körnung (Textur, Bodenart), deren Bestimmung und Darstellung in Dreiecksdiagrammen und Kornverteilungskurven. Insbesondere wird auf die Korngrößenfraktion des Schluff eingegangen und Parallelen zum Löss gezogen. Die an die Textur geknüpften ökologischen Schlüsselmerkmale werden erläutert.
In Folge werden Zustandsstufen, Aufgaben und Funktionen des Bodens erläutert und die Entwicklung einzelner Böden dargestellt. Dies erfolgt auf Basis der Mineralisierung der organischen Substanz, der Humusbildung, seine ökologischen Eigenschaften bis zur Initialbodenbildung. Diese leitet über zur Darstellung von ausgereiften Böden. Die Überleitung erfolgt auf Basis von holozänen Bodenentwicklungsfolgen und Bodencatenen.
Über verschiedene Prozessmechanismen entstehen diverse Bodentypen, welche sich in Chronosequenzen, Toposequenzen und Catenen darlegen lassen. Bodenentwicklungsfolgen in Mitteleuropa werden als Folge von Prozessen im Boden thematisiert und die jeweiligen Standorteigenschaften herausgestellt. Die zuvor gelernte Schichtstufengenese wurde bereits mit hydrologischen Aspekten verknüpft und das Wissen jetzt mit bodenkundlichen Informationen angereichert. Zu diesen gehören die biologische Aktivität und das Bodengefüge, die wiederum mit der mechanischen Verdichtung des Bodens verknüpft sind. Ferner werden Aspekte aus der Hydrologie wiederaufgenommen und mit bodenkundlichen Aspekten wie den Porenraum und Auenböden in Bezug gesetzt. Wasser spielt ebenfalls eine Rolle bei Bodenprozessen, den Redoxreaktionen.
In der inhaltlich vorletzten Vorlesung zum Thema Boden werden die Tonminerale noch einmal strukturell erörtert und ihr Stellenwert im Bodenprofil dargestellt. In diesem Zusammenhang werden neben dem Aufbau der Silikate die Kationenaustauschkapazität und der isomorphe Ersatz behandelt. Mit der Azidität werden Begrifflichkeiten wie Basensättigung, Versauerung und Pufferung mit Bodenprozesse wie die Tonverlagerung verknüpft. Speziell wird auf die Pedogenese der Podsole eingegangen und im Zusammenhang mit der Dünenbildung als Doppelbodenprofil thematisiert.
Von den Redoxprozessen überleitend gehen wir auf die Rolle des pH Wertes des Bodens in Bezug zu ablaufenden Prozessen der Bodenbildung und charakteristischen Bodentypen ein. Final greifen wir noch einmal unser Wissen aus der Karstverwitterung auf und verknüpfen diese mit Chronosequenzen der Bodenentwicklung. Dabei gehen wir auf Prozesse ein, die mit abnehmendem pH-Wert oder auch mit einem sich ändernden Klima einsetzen und damit die genetische Entwicklung von Böden einleiten. Speziell werden Prozesse der Verbraunung, der Verlehmung und der Lessivierung in Kontext der Braunerde und der Parabraunerde gestellt. Diese werden zusammenfassend noch einmal in einer Toposequenz als Bodengesellschaft der Jung- und Altmoränen sowie auf Granit vorgestellt.
Diese Einheit dient ausschließlich der im schnelldurchlauf präsentierten Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte aller Vorlesungseinheiten im Sommersemester 2020. Es wird empfohlen, diese Folien zur Kenntnis der Schwerpunkte für die mündliche Prüfung genau einzustudieren!