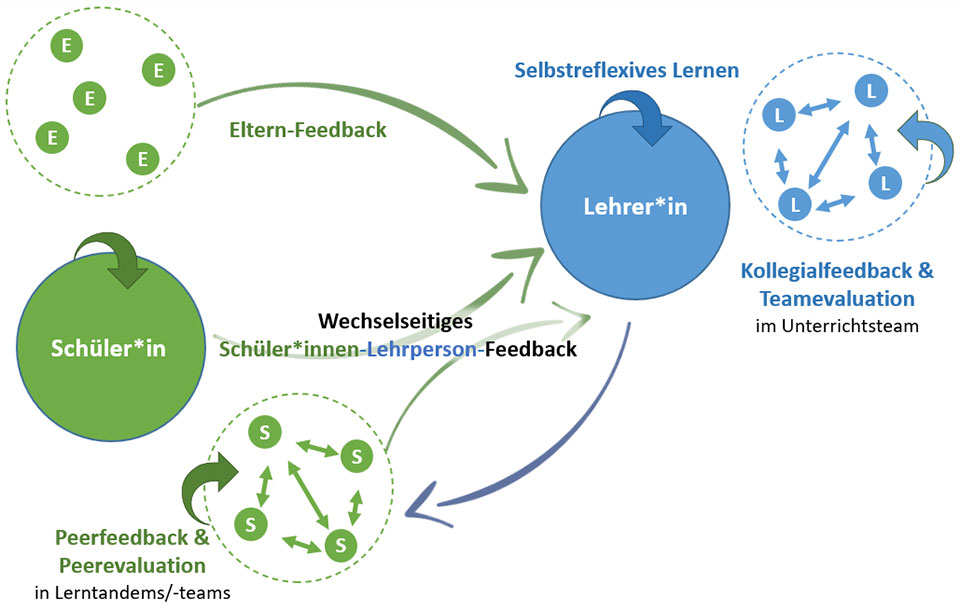-
07 - 28.04.25 UT Planungen_Feedback_Workshops/Fortbildung
-
Das Video erklärt, dass Collective Teacher Efficacy (CTE) – also der gemeinsame Glaube eines Lehrerinnenteams an die eigene Wirksamkeit – laut John Hatties Forschung den größten Einfluss auf den Lernerfolg von Schülerinnen hat.
-
CTE hat einen Effektstärkewert von 1.57, was extrem hoch ist (Vergleich: 0.4 gilt als "durchschnittlicher" positiver Effekt). Es bedeutet, dass Lehrkräfte gemeinsam überzeugt sind, dass sie durch ihre Arbeit das Lernen aller Schüler*innen deutlich verbessern können – unabhängig von äußeren Umständen wie sozioökonomischem Hintergrund.
-
Schulen mit hoher CTE zeichnen sich dadurch aus, dass Lehrer*innen zusammenarbeiten, ihre Praktiken reflektieren und gegenseitig an den Lernfortschritten arbeiten.
-
Die Kultur an solchen Schulen fördert kontinuierliche Verbesserung, Fokus auf evidenzbasierte Praktiken und eine starke Verantwortungsübernahme für die Erfolge (oder Misserfolge) der Schüler*innen.
-