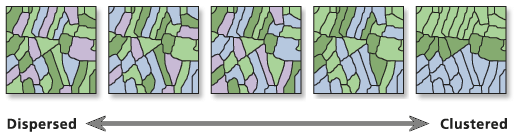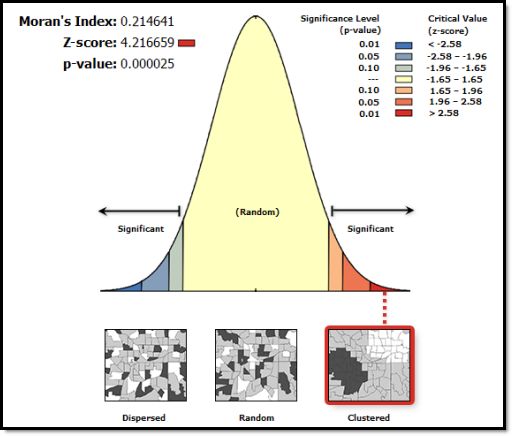Abschnittsübersicht
-
Beschreibende Statistik
-
-
Häufigkeitsverteilung
- "Funktion" (stetig oder diskret) der Verteilung von Werten in einem Datensatz
- grafische Darstellung der Verteilung eines Datensatzes geeignet zur statistischen Beschreibung von Datensätzen
- Histogramm: Häufigkeitsverteilung kardinal skalierterMerkmale
- Entscheidend für die Darstellung (diagrammatisch, kartografisch, etc.) und Interpretation eines Datensatzes!

https://www.youtube.com/watch?v=cBuxgw-ZvV0
https://chartio.com/learn/charts/histogram-complete-guide/
-
-
Die Ausprägungen einzelner Merkmale werden anhand von Skalen gemessen, welche sich aufgrund ihrer formalen Eigenschaften einem von vier verschiedenen Skalentypen zuordnen lassen. Die vier Skalentypen, welche man in Anlehnung an STEVENS (1946) als Nominal-, Ordinal-, Intervall- und Rationalskala bezeichnet [1], unterscheiden sich voneinander dadurch, dass je nach Skalentyp Beziehungen unterschiedlicher Qualität zwischen den einzelnen Merkmalsausprägungen hergestellt werden können.
Diese Zuordnung einer Skala zu einem Skalentyp ist insofern von grundlegender Bedeutung, da durch diesen automatisch jene statistischen Techniken festgelegt werden, welche man auf die Variable, deren Ausprägungen anhand der jeweiligen Skala gemessen worden sind, anwenden darf.
-
Thomas Schöftner (2016) Variablenarten nach Ihem Skalenniveau unterscheiden.- Linz. Video. Web: https://youtu.be/gTJ5O5GNzt4 (22.11.2017)
-
Linktipp: Universität Zürich (2017) Methodenberatung. Zürich. Web: http://www.methodenberatung.uzh.ch/de.html (22.11.2017)
-
-
-
Als Lageparameter bezeichnet man jene Kennzahlen, deren Aufgabe die Charakterisierung der Lage einer Häufigkeitsverteilung durch einen zentralen Wert ist. Die meistverwendeten Lageparameter sind Modus, Median sowie arithmetisches und geometrisches Mittel.
Nachfolgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung, wobei die für einen Skalentyp jeweils am besten geeigneten Parameter durch Fettschrift gekennzeichnet sind. Details entnehmen Sie bitte der Textseite im Link.
Skalentyp
Lageparameter
Nominalskala
Modus
Ordinalskala
Median, Modus
Intervallskala
arithmet. Mittel, Median, Modus
Rationalskala
geometr. Mittel, arithmet. Mittel, Median, Modus
-
Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend?
Autor: Thomas Schöftner (2017). Linz
-
-
-
Die Tabelle enthält eine Zusammenfassung, wobei die für einen Skalentyp jeweils am besten geeigneten Parameter durch Fettschrift gekennzeichnet sind. Details entnehmen Sie bitte der Textseite im Link.
Skalentyp
Streuungsparameter
Nominalskala
Keine
Ordinalskala
Spannweite
Intervallskala
Varianz, Standardabweichung, Spannweite
Rationalskala
Variationskoeffizient, Varianz, Standardabweichung, Spannweite
-
-
-
Die Korrelationsanalyse hat die Aufgabe, die Art sowie die Stärke des Zusammenhanges zwischen den jeweiligen Variablen durch geeignete Maßzahlen zu charakterisieren.
Wie die Theorie zeigt, können derartige Maßzahlen, welche man als Korrelationskoeffizienten bezeichnet, sowohl für ordinal- als auch für intervall- und rationalskalierte Variable ermittelt werden.
.
- Alter vs. Gehalt: R stark positiv

.
- Alter Ehemann vs. Alter Ehefrau: R stark positiv
.
-
Seehöhe vs. Umgebungstemperatur: R stark negativ
.
- Arbeitslosenrate vs. Abstand bei der letzten Wahl: R ~ 0
-
1.) Störche und Geburtenrate
2.) Schuhgröße und Einkommen
-
Die Bedeutung des Pearsonschen Korrelationskoeffizienten für die Regressionsanalyse liegt darin, dass er wesentliche Information betreffend das Verhältnis zwischen gegebenen Daten und Regressionsgeraden enthält.
- Zum einen legt das Vorzeichen des Pearsonschen Korrelationskoeffizienten fest, ob ein direkter oder indirekter Zusammenhang zwischen zwei Variablen besteht, und ob somit die Regressionsgerade monoton wächst (sofern r > 0 ist) oder monoton fällt (sofern r < 0 ist).
- Zum anderen bringt der Betrag des Pearsonschen Korrelationskoeffizienten die Stärke des linearen Zusammenhanges zwischen zwei Merkmalen zum Ausdruck und stellt somit eine Maßzahl für die Güte der Approximation der gegebenen Datenpunkte durch die Regressionsgerade dar (siehe nachfolgende Abbildungen).
-
-
-
- Wählen Sie die Option In Map-Viewer öffnen.
Zunächst zeigt die Karte alle Gemeinden Österreichs, farblich nach Bundesland unterschieden. - Mit dem Werkzeug Style ändern sind weitere Eingaben möglich.
in
- Zunächst als Attribut die Einwohnerzahl einstellen.
- Dann die Optionen des Darstellungsstils ändern.
- Daten klassifizieren auswählen, die Anzahl der Klassen und die Art der Klassifizierung festlegen.
- Natürliche Unterbrechung: An "Lücken" in den Datenwerten werden Klassengrenzen gesetzt.
- Gleiches Intervall: Die Klassen sind alle gleich breit.
- Standardabweichung: Die Klasseneinteilung folgt dem Streuungsmaß.
- Quantil: In jeder Klasse sind gleich viele Regionen.
- Manuelle Unterbrechung
-
- Mit Klick auf die Zahlen (Klassengrenzen) neben dem Diagramm werden diese manuell eingestellt .
- Mit OK und Fertig abschließen
Die Sinnhaftigkeit dieser Darstellungsform, die Art der Karte bzw. des Kartogramms, werden wir im Lernkurs Thematische Kartographie diskutieren. Im Moment genügt die Standardeinstellung, welche einen schnellen optischen Eindruck liefert.
Die Daten wurden von Robert Vogler (2016 - Universität Salzburg) zusammengestellt. Herzlichen Dank!
- Wählen Sie die Option In Map-Viewer öffnen.